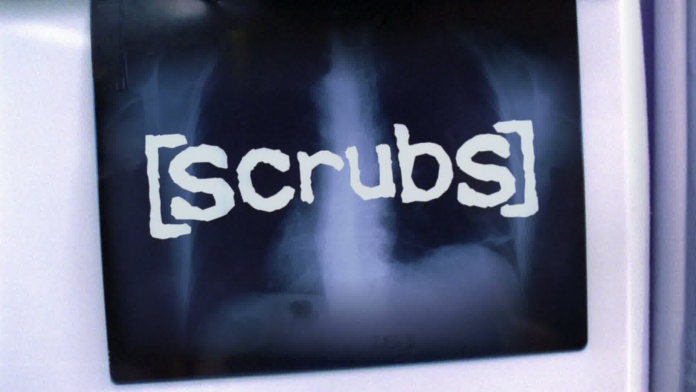
Tagträume, Operationen und Hausmeister. "Scrubs" war lange Zeit integraler Bestandteil der TV-Comedy-Landschaft. Aber was bleibt drei Jahre nach Serienende? Ein Gedankenstrom.
Wie viele Sitcoms hat ProSieben mittlerweile eigentlich im Programm? „Two and a Half Men“, „How I Met Your Mother“, „The Big Bang Theory“, „2 Broke Girls“, „New Girl“, „Apartment 23“ und jüngst dazu gekommen: „Mike und Molly“. Und das sind nur die Serien, die das Abend-Programm füllen. Am Vor- und Nachmittag laufen dann noch Wiederholungen von einigen der genannten Serien und zusätzlich „Malcolm mittendrin“ und „Scrubs – Die Anfänger“. Nun ist „Scrubs“ mittlerweile auch seit gut drei Jahren abgesetzt. Demnach häufig dürften mittlerweile auch die einzelnen Folgen in Dauerschleife über die Mattscheibe geflimmert sein. Das hat wahrscheinlich nicht nur rein qualitative Gründe. Im Vergleich mit den zig anderen Fließband-Comedys stellte „Scrubs“ aber, zumindest in seinen Anfangstagen, eine gewisse Qualitätsspitze dar. Aber der Reihe nach.
Die Figuren
In „Scrubs“ geht es, wie der Titel schon sagt, um Anfänger. Genauer gesagt, junge Medizinstudenten, die frisch von der Universität kommen und in den ruppigen Krankenhausalltag geschmissen werden. Hauptfigur ist John Dorian (Zach Braff), von allen nur J.D. genannt, sowie sein bester Freund – wie die Serie allzu oft betont, „No Homo!“ – Christopher Turk (Donald Faison). In der ersten Folgen werden dann auch noch die weiteren Charaktere eingeführt: Die leicht neurotische und im Umgang mit ihren Mitmenschen etwas tollpatschige Anfängerin Elliot Reid (Sarah Chalke); die toughe Krankenschwester Carla Espinosa (Judy Reyes); der abgebrühte Chefarzt Dr. Bob Kelso (Ken Jenkins); der rebellische Oberarzt mit latentem Hang zu langen Schimpftiraden, Dr. Perzival „Perry“ Cox (John C. McGinley) sowie ein dezent verrückter Hausmeister (Neil Flynn). Schauspielerisch konnte man der Serie auch wenig vorwerfen. Gerade der Hauptcast hatte sich nach der ersten Staffel wunderbar eingespielt. Sowohl die eigenen Rollen als auch das Zusammenspiel untereinander funktionierte wunderbar. Und selbst die Nebenrollen waren sehr gut besetzt. Robert Maschio (Todd), Sam Lloyd (Ted) oder Johnny Kastl (Doug) lieferten als fester Teil des Ensembles tolle Darstellungen ab. Sogar Figuren, die relativ schnell wieder aus der Serie verschwanden (zumeist Liebschaften von J.D.), waren meist durch die Bank überzeugend gespielt.
Das Krankenhaus
In den ersten ungefähr drei Staffeln geht es dann hauptsächlich um den Beruf als junger Arzt, der zwischen dem jugendlichen Idealismus, ein Halbgott in Weiß zu sein, und dem alltäglichen Realismus, dass man ein Angestellter eines Betriebes ist, der irgendwie am Laufen gehalten werden sowie finanziell über die Runden kommen muss, angesiedelt ist. Das Szenario allein ist schon interessant genug und sorgt für einige dramatische und tragische Momente sowie einige ernüchternd realistische Situationen. Auch wenn nicht alles 1:1 auf deutsche Verhältnisse übertragbar ist (dazu ist das Versicherungssystem zu unterschiedlich), bekommt man doch interessante Einblicke. Ab der vierten Staffel baut der „Realitätsanspruch“ genauso merklich ab wie das Interesse, Eindrücke aus dem Klinik-Alltag zu schildern. Ab da geht es dann mehr darum, zu heiraten, Kinder zu kriegen und ein Haus zu bauen. So weit, so bekannt, so konservativ; dass Dr. Cox und seine Ex-Frau Jordan (Christa Miller, im wirklichen Leben liiert mit Serienschöpfer Bill Lawrence) im weiteren Verlauf der Serie in „wilder Ehe“ leben, dürfte noch am unkonventionellsten sein. Natürlich läuft man Gefahr, in Routine abzurutschen, wenn man immer dieselben Geschichten erzählt, und in einem Krankenhaus gibt es nicht jeden Tag wichtige medizinische Rätsel zu lösen. Dennoch ist es sehr schade, dass sich am Ende alle Handlungsstränge um Turks und Carlas Eheprobleme oder J.D.s und Elliots „Kriegen’se sich, oder nich?“-Beziehung drehen. Die viel gescholtenen letzten beiden Staffeln – um genau zu sein Staffel acht und Staffel neun – beziehungsweise die erste Staffel der angedachten Spin-Off-Nachfolger-Serie „Med School“ – versuchten zumindest, mit den Figuren etwas Neues zu machen, indem sie die Perspektiven umdrehten. Nach acht Jahren im Dienst waren J.D., Turk und Elliot in der Position, die Dr. Cox und Dr. Kelso am Anfang der Serie inne hatten. Aus Schülern waren Lehrer geworden, die sich mit den neuen Anfängern rumärgern mussten.
Der Humor
„Rumärgern“ ist dabei ein gutes Stichwort. Dass die letzten Staffeln von „Scrubs“ quotenmäßig scheiterten, lag zu nicht kleinen Teilen wahrscheinlich auch daran, dass die meisten neuen Figuren hoffnungslos blass oder gleich arg unsympathisch waren. Und mittlerweile hatte sich auch jeder Anflug von Humor aus der Serie verabschiedet. Die Entwicklung des Comedy-Aspekts war immer schon eine, um mit Alfred Biolek zu sprechen, interessante Angelegenheit. Die ersten Staffeln von „Scrubs“ waren nicht sonderlich lustig. Zumindest gemessen an Sitcom-Standards. Keine Lacher vom Band, wenig bemerkenswert gesetzte Pointen, nicht viele Running-Gags und oft auch sehr ernste Themen dominierten das Geschehen. Dazu kamen, für Sitcoms auch eher ungewöhnlich, recht blasse Farben und geringes Colour-Grading. Erst mit den späteren Staffeln veränderten sich die Erzählart und damit auch der Humor. Anfangs eher unwichtige Nebenfiguren wie Todd, Ted, Doug oder eben der Hausmeister rückten mehr in den Mittelpunkt, wurden teils sogar zu Hauptfiguren. Das funktionierte eine Zeit lang sogar recht gut. Neue Figuren bringen frischen Wind, und zum Beispiel mit Teds A-Cappella-Gruppe (die es übrigens als „The Blanks“ wirklich gibt) konnte man auch einige lustige Ideen in die Serie einbringen.
Mit zunehmender Laufzeit trat aber das ein, was viele gute Serien kaputt gemacht hat. Der Internet-Slang bezeichnet es als „Flanderization“. Eine Figur, die vorher einen lustigen Tick, eine Marotte hatte, wird vollkommen darauf reduziert und diese Macken werden dann ins Extreme übersteigert. So wurde aus dem Macho Todd der bi- und hypersexuelle Toddster, aus dem überforderten Anwalt Ted ein hoffnungsloser Versager, dessen Schicksalsschläge sich mit denen von Hans Moleman aus „Die Simpsons“ messen konnten, und aus dem Hausmeister schlicht ein gemeingefährlicher Irrer. Bis zu einem gewissen Punkt nimmt man so was ja sogar noch hin. Wenn es für einen guten Witz reicht, warum nicht? Spätestens, wenn dann aber vollkommen unnötige Nebenrollen eingeführt werden, die wirklich nur für einen Witz gut sind und mehr nicht, wird es nervig. Beispiel? Josephine, die kleine Anfängerin aus Staffel sieben mit der latent hohen Heliumstimme.
Diese Entwicklung ging mit einer anderen einher: Die Serie verlor immer mehr die Bodenhaftung. Dinge, die vorher J.D.s Tagträumen vorbehalten waren, geschahen plötzlich in der Serienrealität. Lavernes Gospel-Chor singt auf der Intensiv-Station? In der Krankenhaus-Kanalisation lebt ein Walross? Bettpfannen-Rennen? So was würde in einer Folge „South Park“ funktionieren, nicht aber in einer Serie, die stets betont, dass es hier um echten Krankenhaus-Alltag geht.
Die Musik
Was „Scrubs“ bis zum Ende richtig macht, war die Auswahl des Soundtracks. Auch wenn es eine deutliche Tendenz hin zum üblichen Indie-Geklampfe gab, war die Mischung meist recht bunt. Und einige wirklich markante Verbindungen zwischen Handlung und Musik bekam man auch hin. Colin Hay zu Beginn von Staffel zwei, beispielsweise, mit seinem Song „Overkill“. Oder „Death Cab for Cutie“ aus Staffel acht mit „I’ll follow you into the dark“ zum Tod eines Patienten. Und, natürlich, „The Fray“ mit „How to save a life“, ausgerechnet in einer Folge, in der Dr. Cox mehrere Patienten an Tollwut wegsterben. In dieser Hinsicht bot „Scrubs“ eine gesunde Mischung aus Evergreens und unbekannteren Stücken. Joseph Arthur, die Foo Fighters, Men Without Hats, Leroy, David Gray, R.E.M. (mit einem ihrer schönsten und zu Unrecht unbekannteren Songs „Half a World Away“), U2, Coldplay, Beck, Mark Knopfler – die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Zumindest für eine abwechslungsreiche Playlist sorgte „Scrubs“ immer, und meisten schafften die Macher es auch, die Songs so markant einzusetzen, dass sich mit den Melodien oft die Bilder der Serie verbanden. Dazu kamen noch die immer recht griffigen A-Capella-Auftritte von Teds Band (in der Serie übrigens „Die erbärmlichen Versager“).
Die Episoden
Am deutlichsten bemerkbar machte sich der musikalische Anteil an der Serie natürlich bei der, für amerikanische Serien scheinbar unvermeidbaren, Musical-Episode. Die komponierten Songs haben tatsächlich reichlich Pfeffer, und die Idee, wie man so ein Konzept in die Serie integriert, war ausnahmsweise mal nicht vollkommen herbei konstruiert, sondern sogar im Serienkosmos verankert. In der Hinsicht gelang es meist sogar wirklich, einige schöne Ideen umzusetzen. Die „Zauberer von Oz“-Episode („Mein Weg nach Hause“) transportiert einige schöne Referenzen von Oz ins „Sacred Heart“-Krankenhaus. „Ich und Toto gehen nach Hause“, klasse. Nervig war nur die, gerade am Ende allzu durchschaubare Masche, immer drei Handlungsstränge parallel nebeneinander zu inszenieren. Anfangs war das sicher noch niedlich und mit einigen schicken „Aha“-Effekten verbunden. Nach der fünften Folge, die nach diesem Schema funktionierte, nervte es eher. Dennoch, Folgen wie „Meine Schuld“ mit einem tollen Gastauftritt von Brendan Fraser, „Mein Katalysator“ mit einem ebenso tollen Gastauftritt von Michael J. Fox, oder „Mein Einhorn“ in der sich der „Friends“-Star Matthew Perry zum Besten gibt, entschädigen in der Hinsicht für einiges.
Die „Guy Love“
Auch wenn die Musical-Episode an sich toll ist, ein Song bringt eines der großen Probleme der Serie gut auf den Punkt: „Guy Love“. „And when I say/I love you, Turk/It’s not what it implies“. Mit Homosexualität kam „Scrubs“ nie sonderlich gut klar. Wenn Turk in einer Folge J.D. darauf hinweist, dass „Weiße“ in der Öffentlichkeit nur Tanzen dürften, wenn sie erkennbar homosexuell wären, kann man das vielleicht noch als missglückten Witz abtun. Wenn Dr. Cox später, wenn es um die Erziehung seines Sohns geht, Phrasen fallen lässt wie „Du schleppst ihn schon ständig zum Ballett, bitte lass uns nicht noch den letzten Nagel in seinen schwulen Sarg [sic!] schlagen“, dann muss die Frage erlaubt seien, ob man sich da nicht ein bisschen verrannt hat. Man könnte die Angst der Figur vor einem homosexuellen Sprössling vielleicht im Kontext der Serie mit einem „schlechten Beispiel“ entschuldigen. Dr. Kelsos Sohn Harrison wird auch als Klischeetunte der schlimmsten Sorte inszeniert (bzw. beschrieben, in persona taucht dieser nämlich komischerweise nie auf). Schon als kleiner Junge strickte der nämlich und schaute sich Musicals an. Da ist es natürlich nur noch ein kleiner Schritt zu Nippel-Piercings und minderjährigen Toy-Boys. Versteht sich von selbst, dass sich so jemand auch nur für Sport interessiert, weil er den Spielern die Trikots entwirft. Auf die ehrlich gemeinte Anmerkung einer Figur, dass das doch „stark“ wäre, antwortet Kelso nur mit einem resignierenden „Nein, ist es nicht“. So eine Darstellung von schwulen und „unmännlichen“ Charakteren aber noch viel weniger. Unter diesem Gesichtspunkt erscheinen J.D.s ständige Frauen-Geschichten und zahlreiche Affären auch in einem anderen Licht. Die Implikation, dass eine Hauptfigur tatsächlich schwul sein könnte, war den Machern dann wohl doch etwas viel. Für Lebensentwürfe abseits von „Vater-Mutter-Kind“ hatte „Scrubs“ wenig über. Dr. Zeltzer, bekennender Swinger, wird von der Serie als absolute Witzfigur dargestellt, und die anfangs noch souveräne, resolute und unabhängige Carla wird von Staffel zur Staffel mehr zur Glucke der Gruppe. Und Elliot? Ein Beispiel aus den späteren Staffeln: Sie kann riechen, wenn jemand ein Baby bekommen hat. Case closed.
Am Ende?
Was bleibt also? Im Grunde eigentlich nicht viel. Abseits von Indie-Liebling Zach Braff, der mit seiner Regiearbeit „Garden State“ beachtliche Erfolge feierte und momentan seinen neuen Film „Wish You Were Here“ finanzieren möchte, hat kaum einer der „Scrubs“-Stars groß Karriere gemacht. Donald Faison hat den Sprung aus dem Fernsehen ins Kino nie geschafft. Zuletzt war er im Effekt-Film „Skyline“ zu sehen. Ähnliches gilt für McGinley, Jenkins und Chalke. Die Serie selbst wird in spätestens fünf Jahren wohl leider auch nicht mehr wirklich von Interesse sein. Denn: Wer guckt heute noch „Friends“? Also, wer, der es nicht damals zur TV-Ausstrahlung gesehen hat? Serien – und Sitcoms ganz besonders – haben immer einen nicht zu verachtenden sozialen Aspekt. Es wird geguckt, worüber man mit anderen sprechen kann und demnach, was alle schauen. Die grundsätzlichen Strukturen ändern sich zwar wenig, in dem Rahmen muss es aber trotzdem meist etwas Neues sein. „How I Met Your Mother“, zum Beispiel, ist letztendlich auch „nur“ eine modernisierte Version eben von „Friends“. Ob es irgendwann also ein neues „Scrubs“ geben wird? Auszuschließen ist das nicht, eher im Gegenteil. Aber, welche Sitcoms haben den Test der Zeit wirklich überstanden? Die alten „ALF“– oder „Der Prinz von Bel-Air“-Staffeln, die bei jedem noch irgendwo im Regal stehen, sind heute hauptsächlich aus nostalgischen Gründen interessant. Wirklich plausibel und überzeugend erklären, wieso man den jungen Will Smith mal für den coolsten Typen im Fernsehen hielt, kann man aber wohl nicht. Die Halbwertzeit von Sitcom ist schlicht ziemlich gering. Das muss aber nichts per se Schlechtes sein. „Scrubs“ und seine verwandten Formate unterhalten. Manche besser, manche schlechter. Das macht sie natürlich hauptsächlich zu Unterhaltungsformaten. Aber, wie sagt J.D. in der Folge „Meine Sitcom“ („My Life in Four Cameras“; „Scrubs“ wurde, im Gegensatz zu den meisten Sitcoms, mit einer Kamera gedreht) dann auch so schön passend: „[An solchen Tagen,] ist es gut zu wissen, dass es immer eine Sache gibt, die einen aufheitern kann.“











Interessante Retrospektive. Ich muss sagen, ich konnte nie wirklich was mit "Scrubs" anfangen. Fand den Humor nicht sonderlich lustig und irgendwie konnte ich Zach Braff in der Serie nicht wirklich abhaben. Seltsam, denn Garden State finde ich toll.